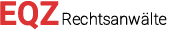Verspätete Zielvorgabe führt zu vollem Schadensersatz
3. Juli 2025Probezeitkündigung trotz Zusage? – LAG Düsseldorf erklärt Kündigung für unwirksam
9. September 2025Mit seinem Urteil vom 1. August 2025 in der Rechtssache C-600/23 – Royal Football Club Seraing hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) zentrale Maßstäbe zur gerichtlichen Kontrolle von Sportschiedssprüchen gesetzt. Die Entscheidung stärkt die Rechtsposition von Berufssportlern und Sportvereinen im Hinblick auf die Überprüfbarkeit von Entscheidungen des Court of Arbitration for Sport (CAS).
Hintergrund des Verfahrens
Ausgangspunkt war ein Streit zwischen dem belgischen Fußballverein Royal Football Club Seraing und dem Weltfußballverband FIFA. Der Verein hatte im Jahr 2015 sogenannte Third-Party Ownership (TPO)-Verträge mit der maltesischen Gesellschaft Doyen Sports abgeschlossen. Diese Verträge sahen die Übertragung wirtschaftlicher Rechte an Spielern auf Doyen vor – ein Vorgehen, das nach den Regularien der FIFA untersagt ist.
Auf Grundlage dieser Vorschriften sanktionierte die FIFA den Klub mit Transfersperren und einer Geldstrafe. Die Sanktionen wurden durch den CAS sowie später vom Schweizer Bundesgericht bestätigt.
Der RFC Seraing hielt die zugrundeliegenden FIFA-Regeln für unionsrechtswidrig und klagte vor belgischen Gerichten. Diese sahen sich aufgrund der Rechtskraft des Schiedsspruchs gehindert, die Sache erneut zu prüfen. Die belgische Cour de cassation legte dem EuGH daraufhin ein Vorabentscheidungsersuchen vor.
Kernaussagen des EuGH
Der Gerichtshof urteilte, dass nationale Gerichte nicht durch Grundsätze der Rechtskraft daran gehindert werden dürfen, Schiedssprüche des CAS auf ihre Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht zu prüfen. Insbesondere gilt dies, wenn das Schiedsverfahren nicht auf freiwilliger Basis, sondern aufgrund einseitiger Vorgaben eines Sportverbands – wie der FIFA – erfolgte.
Der EuGH stellte klar:
1. Wirksame gerichtliche Kontrolle: Nationale Gerichte müssen befugt sein, die Vereinbarkeit von CAS-Schiedssprüchen mit den Grundfreiheiten und dem Wettbewerbsrecht der Union eingehend zu überprüfen – auf Antrag oder sogar von Amts wegen.
2. Unanwendbarkeit entgegenstehender Regelungen: Nationale Vorschriften oder Regelwerke sportlicher Organisationen, die einer solchen Kontrolle entgegenstehen, sind unangewendet zu lassen.
3. Vorrang unionsrechtlicher Prinzipien: Der effektive Rechtsschutz gem. Art. 47 der Charta der Grundrechte der EU verlangt, dass Sportler und Klubs auch im Rahmen von Schiedsverfahren Zugang zu unabhängigen und unparteiischen Gerichten haben.
4. Vorabentscheidungsverfahren und einstweiliger Rechtsschutz: Auch im Rahmen solcher Verfahren muss es möglich sein, eine Vorlage an den EuGH zu veranlassen und einstweilige Anordnungen zu erwirken.
Einordnung und Folgen
Das Urteil hat erhebliche praktische Relevanz für die Autonomie des Sports und die Grenzen der Schiedsgerichtsbarkeit. Es bestätigt einerseits die grundsätzliche Zulässigkeit von Schiedsverfahren im Sport, betont jedoch, dass diese nur im Einklang mit den Grundsätzen der öffentlichen Ordnung der Union stehen dürfen.
Der Gerichtshof setzt damit ein klares Zeichen gegen eine „gerichtsfreie Zone“ im internationalen Sportrecht. Besonders betroffen sind Verbände wie die FIFA oder UEFA, deren Regelwerke nun stärker unter unionsrechtlichen Prüfungsmaßstäben stehen.
Fazit
Das Urteil des EuGH markiert einen wichtigen Schritt zur Stärkung des Rechtsschutzes im professionellen Sport. Die uneingeschränkte Bindungswirkung von CAS-Entscheidungen wird durchbrochen – zugunsten einer justiziellen Kontrolle, die unionsrechtlichen Maßstäben genügt. Für nationale Gerichte bedeutet dies eine klare Aufforderung: Rechtsschutz darf nicht an der Schwelle zum Sportschiedsgericht enden.